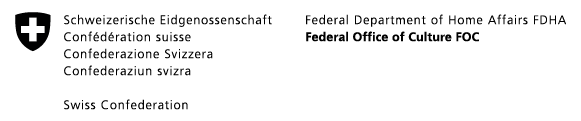Ihr «Baby»
Von Dennis Palumbo
Früher war ich Autor von Hollywood- und Fernsehfilmen, inzwischen bin ich zugelassener Psychotherapeut mit dem Spezialgebiet Kreativität. Oft werde ich gefragt, was mein vordringlichstes Ziel ist, wenn ich mit Autoren arbeite. Aber da gibt es leider keine eindeutige Antwort. Es kommt ganz darauf an, mit welchen Fragen und Problemen mein Patient in die Therapiesitzung kommt. Aber unter der Vielzahl von persönlichen und beruflichen Zielen, die wir gemeinsam versuchen anzugehen, kristallisiert sich immer wieder eine wichtige Sache heraus, und zwar die Notwendigkeit, dass der Autor oder die Autorin, ein "gutes Verhältnis" zu seinem/ihrem Talent entwickelt.
Was möchte ich damit sagen? Lass mich zuerst mit einer Frage antworten, die ich oft den Leuten stelle, die meine Schreibseminare und -workshops besuchen: Behandelst du dein Handwerk, deine Schreibbegabung so, wie du selber als Kind behandelt worden bist?
Zum Beispiel: Wenn du als Kind ständig kritisiert und verurteilt wurdest, gehst du dann mit deinen Texten genauso kritisch ins Gericht? Ist ein Tag, an dem es mit dem Schreiben schlecht funktioniert, gleich ein Grund für Selbstzweifel und Selbstanklage?
Oder ein anderes Beispiel: Wenn deine Eltern von dir verlangt haben, dass du der "perfekte" Junge, oder das "perfekte" Mädchen bist, wenn du niemals Fehler machen durftest und immer dein Bestes geben musstest, ist es dann nicht so, dass du an dein Schreiben die gleichen Anforderungen stellst? Und so wie Eltern oft ihre "perfekten" Kinder dazu benutzen, ihr eigenes Selbstwertgefühl als Eltern (und als Menschen) zu steigern und zu stützen, brauchst du nicht auch den Erfolg beim Schreiben, um vor die selber zu bestehen?
Wenn ich mit Patienten aus der schreibenden Zunft arbeite, bin ich oft betroffen, welche Gefühle da zum Ausdruck kommen, wenn es um ihre Arbeit geht: Wut, Enttäuschung oder sogar Ekel. Als ob ihr Talent "zu sich kommen" würde, wenn sie ihm drohen, ihm schmeicheln oder vernünftig darauf einreden.
Einmal hatte ich eine Patientin, die hatte begonnen, eine Erzählung zu schreiben. Aber sie war so frustriert von den Anfangsseiten, dass sie die Seiten mit in meine Praxis brachte, um sie vor mir zu zerreißen! Sie hasste ihre Arbeit, und was sie empfand, das sagte viel über sie aus.
Als wir näher auf ihre Gefühle eingingen, kamen viele Erinnerungen an beißende, verächtliche Ausbrüche des Vaters bezüglich ihrer Intelligenz und ihrer beruflichen Perspektiven in ihr hoch. Damit machte er ihr klar, wie enttäuscht er von ihr war. Jetzt, als Erwachsene, machte sie ihrer eigenen Enttäuschung über ihr Schaffen Luft, und zwar warf sie ihm dieselbe Wertlosigkeit vor, die ihr damals vorgeworfen wurde. In ihren Augen verdiente ihr Schaffen nichts als ihre wütende Verachtung.
Bei diesen Zeilen erinnere ich mich an eine Geschichte, die sich vor ein paar Jahren ereignet hat. Ich fuhr von einer Party nach Hause und bemerkte irgendwann, dass ich meine teure Lederjacke bei meinem Gastgeber vergessen hatte. Ich ärgerte mich über mich selbst, wendete den Wagen und fuhr zurück, und die ganze Zeit über schimpfte ich vor mich hin von wegen meiner Dummheit und Vergesslichkeit. Doch mitten in dieser Litanei der Selbstbeschuldigung und Selbstzerfleischung hielt ich inne - und es war, als ob ich mich selbst das erste Mal hören würde. Ich war schon immer ziemlich hart zu mir selbst, vor allem dann, wenn ich Fehler gemacht hatte. Aber als ich meiner eigenen Schimpferei zuhörte, merkte ich plötzlich, dass ich mich so verhielt, als verurteilte ich das größte Verbrechen des Jahrhunderts. Und das wegen einer Jacke, um Gottes Willen…
Dann, aus irgendeinem Grund, stellte ich mir mich selbst vor, als sechsjährigen Jungen auf dem Beifahrersitz. Und ich stellte mir weiter vor, dass der arme Junge seine Jacke bei Freunden vergessen hätte und ich in dieser Art und Weise mit ihm schimpfte. Die ärgerlichen, beschämenden Worte blieben mir im Hals stecken.
Ich habe diesen Moment nie vergessen, und er spielt sich jeden Tag in ähnlicher Weise in meiner therapeutischen Praxis ab: Autoren, die von ihrer Arbeit erwarten, dass sie ihr Selbstbild stärkt und sie als talentiert und der Mühe wert bestätigt; Autoren, die auf ihr Talent schimpfen, wenn es ihre Erwartungen nicht erfüllt; Autoren, die in einer widersprüchlichen, feindlichen Dynamik mit ihrem "Kind", ihrem Schreiben verbandet sind.
Die Ironie des Ganzen ist offensichtlich. Denn wie oft haben wir schließlich von Autoren gehört, dass sie ihr Skript als ihr "Baby" bezeichnen? Aber wer, verdammt noch mal, geht mit einem Baby so um wie viele Autoren mit ihrer Arbeit?
Nehmen wir einmal folgende Situation: Wenn dein sechsjähriges Kind mit einer Zeichnung zu dir kommt, die es im Kunstunterricht gemalt hat, würdest du wirklich dazu sagen: "Das nennst du ein Bild? Wie kommst du dazu, zu denken, dass du ein Künstler bist? Wenn das alles ist, was du zustande bringst, dann solltest du besser etwas anderes tun. Daraus wird nie etwas Vernünftiges. Und abgesehen davon: Was meinst du, wie ich mich fühle, wenn ich ein Kind habe, das so schlecht zeichnet? Es ist mir peinlich, so ein Kind zu haben."
Und nur angenommen, du wärest jetzt dieses Kind: Wie versessen wärest du darauf, solchen Eltern dein nächstes "Werk" zu zeigen? Würdest du dich nicht stattdessen beschämt, unwürdig und ungeliebt fühlen?
Die eben beschriebene Szene scheint lächerlich und unglaubwürdig. Das gebe ich zu. Aber viele Autoren hadern innerlich täglich in ähnlicher Weise mit ihrer eigenen Arbeit.
Worüber wir jetzt sprechen, ist die Tendenz, mit der Arbeit ins Gericht zu gehen - streng, ungerecht und andauernd. Und tatsächlich ist für den Großteil meiner schreibenden Patienten in ihrem Berufsalltag der permanente Kampf gegen ihren "inneren Zensor" ein wichtiges Thema. Es ist der Kampf gegen eine dauernde, barsche und fast immer beschämende "Stimme", die ihre Arbeit herabsetzt oder entkräftet.
Tatsächlich ist in unserer Kultur der "innere Zensor" eine so bekannte Vorstellung, dass Millionen von Dollars für Bücher, Tonbänder und Seminare ausgegeben werden, die versprechen, die peinigende innere Stimme, unter der die meisten leiden, zum Schweigen - oder ganz zum Verstummen - zu bringen.
Das Problem, die Sache so anzugehen, ist meiner Meinung nach ein doppeltes: Das Ziel, den selbstkritischen, zensierenden Teil der eigenen Psyche zu eliminieren, bestärkt gleichzeitig in der Vorstellung, dass mit der eigenen Psyche etwas nicht stimmt, und deshalb muss sie repariert werden. Des weiteren impliziert diese Vorstellung, dass es ein vervollkommnungsfähiges "Du" geben könnte, das von solchen Konflikten unbelastet ist. Mein zweiter Einwand ist ganz banal: So etwas ist nicht möglich.
Es ist keine Frage, dass während des Schreibprozesses nichts qualvoller ist, als gegen die Gefühle von Selbstzweifel oder sogar Selbsthass ankämpfen zu müssen. Ich habe mit Patienten gearbeitet, die im wahrsten Sinne des Wortes alles hassen, was sie schreiben –nichts ist gut genug, witzig genug, raffiniert genug, kommerziell genug. Sogar diejenigen, deren Blick auf ihre Schaffen nicht ganz so kritisch, sondern ausgewogener ist, müssen zugeben, dass es ein Stress ist, ständig diese verborgene kritische innere Stimme in Schach halten zu müssen, um arbeiten zu können.
Die innere Stimme "zum Schweigen zu bringen" ist nicht nur unmöglich; es ist auch gar nicht wünschenswert. Sie ist ein Teil dessen, was du bist, und zwar ein notwendiger Teil, genauso wie deine Begeisterung, deine Arbeitsgewohnheiten, deine Vorlieben und Abneigungen, deine Freuden und Leiden. Und wie diese anderen Aspekte deiner psychischen Verfassung ist auch der innere Zensor ein zweischneidiges Schwert.
Betrachte es einmal von der Seite: Die gleiche innere Stimme, die so hart mit deiner Arbeit ins Gericht geht, befähigt dich auch dazu, deine Vorlieben und das, was du ablehnst, wahrzunehmen. Sie befähigt dich, dir eine Meinung zu bilden und Entscheidungen zu treffen. Sie bestärkt dein Vertrauen in deine subjektive Erfahrung, die dir gestattet, dies etwas anderem vorzuziehen.
Wir benötigen ein gewisses Urteilsvermögen, um uns in dieser Welt zurecht zu finden. Und wie bei fast allem kommt es auf die Ausgeprägtheit und Intensität dieses Urteilsvermögens an. Es ist eine Gratwanderung, und es bleibt zu hoffen, dass wir weder zuviel noch zu wenig davon besitzen.
Stell dir vor, du willst eine Straße an einer stark frequentierten Kreuzung überqueren: Ist dein Urteilsvermögen zu wenig ausgeprägt, ignorierst du das Stopp-Zeichen und rennst einfach über die Straße. Ist es aber andrerseits zu stark ausgeprägt, orientierst du dich eisern an den Vorgaben der Ampel und gehst erst los, wenn sie auf Grün steht, auch wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist.
Was ich dir sagen möchte, ist Folgendes: Wir müssen nicht zu streng mit unserem inneren Zensor ins Gericht gehen. Es ist Anstrengung genug, angesichts einer ständigen, anhaltend kritischen inneren Stimme zu schreiben. Und deshalb ist es lächerlich, das Problem zu verschlimmern, indem man sich selbst für diesen ständigen Kampf tadelt.
Erinnere dich auch daran, dass ich sagte, dieser innere Zensor sei ein zweischneidiges Schwert. Denn wenn wir behutsam mit diesem beunruhigenden Aspekt unserer Persönlichkeit umgehen, dann können wir auch etwas lernen.
Ich denke da beispielsweise an eine Erfahrung, die ich selbst als Patient in einer Therapie gemacht habe. Es ist viele Jahre her, als ich mit einigen sehr schmerzlichen Fragen kämpfte. Es ging besonders um ziemlich tiefsitzende Versagensängste, die mich trotz meiner Erfolge als Drehbuchautor quälten. Die Sitzungen zehrten so an mir, dass ich überlegte, die Therapie zu beenden.
Trotzdem ging ich zu meiner eigenen Verwunderung weiter zu den Sitzungen, Woche für Woche,. Als ich das meinem Therapeuten gegenüber erwähnte, wies er mich darauf hin, dass die Probleme, die meiner Versagensangst zugrunde lagen, zwar in der Tat schmerzlich und schwierig waren, dass es wiederum aber auch genau dieselbe Versagensangst war, die mich dazu brachte, weiterhin jede Woche in die Therapie zu gehen. Mit anderen Worten: Die Sache, die der Grund für meine Probleme war, brachte mich auch zu dem Entschluss, mich wild gegen sie zu wehren. Ich wollte eben nicht aufgeben.
Hier wurde mir klar, dass mein spezielles Problem zwei Seiten hatte. Wie die alte Vorstellung von Yin und Yang, so hat fast jeder Aspekt unserer Gefühlswelt zwei Seiten, eine bestärkende Seite und eine, die kraftlos macht. Unsere Aufgabe ist es deshalb, ein Problem, das uns aufwühlt - wie zum Beispiel der hartnäckige innere Zensor - zu prüfen und zu lernen, welche positiven und welche negativen Auswirkungen es auf unser Leben und auf unser Schaffen hat.
Wenn wir aus dieser Perspektive an unseren inneren Zensor herangehen, aus der Perspektive eines lebenslangen Prozesses der Prüfung, gibt es eine Form der Koexistenz, gibt es die Möglichkeit, trotz des Gefühls des Schmerzes ob seines intensiven, forschenden Blickes den Mut zu entwickeln, Aspekte der Selbstverteidigung herauszufordern und zu stärken. Das war schon immer das Dilemma der Künstler. Und das ist es, was Rollo May als "schöpferischen Mut" bezeichnet.
Man kann es aber auch einfacher ausdrücken: Du bist ein Autor, und deshalb bist du manchmal dein härtester Kritiker. Und damit meine ich, um zu meiner anfänglichen Metapher zurückzukehren: Manchmal bist du gegenüber deinem künstlerischen Streben ein unvernünftiges, anspruchsvolles, gnadenloses "Elternteil".
Wichtig ist: vergiss nie, dass du jederzeit den Glauben an deine Arbeit verlieren kannst, auch wenn du generell zuversichtlich und mit deinem Schreiben zufrieden bist.
Vor Jahren hatte ich eine Drehbuchautorin als Patientin, die immer behauptete, es gäbe zwei große Lieben in Ihrem Leben: ihre halbwüchsige Tochter Susie und ihr Schreiben. Ich erinnere mich lebhaft an die Kämpfe, die sie vor allem in einer bestimmten stürmischen Lebensphase durchlebt hat. Ihre letzten zwei Drehbücher waren im Filmstudio "einen langsamen Tod" gestorben, und eines, an dem sie arbeitete, war gerade an einen anderen, jüngeren und damit "heißeren" Autoren weiter gegeben worden.
Zu Hause hatte sie täglich Auseinandersetzungen mit ihrer Tochter, die immer aufsässiger wurde. Schließlich kam meine Patientin während einer Sitzung zu einer schmerzlichen Erkenntnis. "Kürzlich", sagte sie zögernd, als ob sie verwirrt wäre von dieser Idee, "hatte ich das Gefühl, dass ich das, was ich liebe, nicht mag."
Ihr Dilemma war leicht zu erkennen. Sie stand in den 40ern, und sie hatte hart gearbeitet, um als Drehbuchautorin Karriere zu machen. Sie hatte einen mäßigen Erfolg gehabt, ein bis zwei Sachen wurden produziert, und in der Folge war Geld geflossen. Außerdem gab es immer irgendeinen Auftrag, auch wenn es nur eine Überarbeitung war, und ihr Agent reagierte immer auf ihre Anrufe. Aber was viel wichtiger war: Sie liebte das Schreiben immer…
Aber in den letzten Jahren veränderte sich alles langsam zum Negativen. Sei es, dass sie auf Grund ihres Alters diskriminiert wurde, sei es der veränderte Markt, auf jeden Fall stagnierte ihre Karriere. Vielleicht war auch ihre kreative Energie erschöpft: So etwas kann nach einer Scheidung und einem Neubeginn als Alleinerziehende durchaus passieren. Warum auch immer, die Arbeitsangebote wurden spärlicher. Ihre Arbeit wurde des öfteren abgelehnt oder musste in großem Stil umgeschrieben werden. Und so versank sie in eine Gemütsverfassung, die Sartre vielsagend als "Verständnislosigkeit und Wut" beschrieben hat.
Ihre Tochter Susie, inzwischen 16 Jahre alt, entwickelte sich zu einer pubertären Herausforderung, die einen oft wütend machte und das Ideal bedingungsloser elterlicher Liebe hart auf die Probe stellte. Ihre Rebellion - von den Therapeuten wertneutral "Phase der Differenzierung" genannt - nahm die üblichen Formen an: Sex, Drogen und eine beinahe krankhafte Unfähigkeit, ihrer Mutter auch nur in irgendeinem Punkt zuzustimmen.
Als wir in dieser Zeit zusammenarbeiteten, wiederholte ich die Worte meiner Patientin immer wieder in Gedanken. "Kürzlich hatte ich das Gefühl, dass ich das, was ich liebe, nicht mag." Äußerlich betrachtet war klar, was sie meinte: Sie liebte ihre Tochter, und sie liebte es, zu schreiben, aber derzeit schien beides nur mit Kummer, Zurückweisung und Demütigung verbunden.
Aber was wollte mir meine Patientin darüber hinaus noch sagen? Wollte sie zum Ausdruck bringen, dass sie etwas oder jemanden nur solange lieben konnte, wie sie es/ihn auch mochte, und zwar in dem Sinn, als sie dafür persönlich oder beruflich angemessen belohnt wurde? Wohl kaum. Das Aufziehen ihrer Tochter war immer ein Kampf, wie es das für die meisten Eltern ist, aber dennoch wuchs ihre Liebe zu Susie mit den Jahren. Und genauso ging es ihr mit ihrer Autorenkarriere, während der sie die gleichen Triumphe und Misserfolge erntete, wie die meisten Autoren es kennen. Dennoch erfüllte sie jede neue Arbeit mit der gleichen atemlosen Erregung, wie sie Astronauten haben, wenn sie ihren Fuß zum ersten Mal auf einen fremden Planeten setzen.
Aber irgend etwas fehlte mir bei ihren Ausführungen. Ich fand es bald heraus, und zwar während einer Sitzung, als ich sie an ihre Bemerkung erinnerte, dass sie das, was sie liebe, nicht mögen würde. Offensichtlich hatte sie vergessen, dass sie so etwas jemals gesagt hatte, und sie war von dieser Äußerung sogar peinlich berührt.
"Ich soll gesagt haben, dass ich Susie nicht mag? Oder das Schreiben?"
Ich nickte. "Es ist nicht so, dass jemand Sie dafür tadeln würde. Aber denken Sie einmal daran, wie es ihnen mit ihrer Tochter im Moment so geht. Zum Beispiel letzte Woche, wo ihr nicht einmal miteinander gesprochen habt.
- Das stimmt. Es hat mich unendlich ermüdet, mir alle zwei Minuten sagen zu lassen, ich solle sie am Arsch lecken.
- Und mit Ihrer Karriere, fuhr ich fort, haben da nicht irgendwelche jugendlichen Klugscheißer, die gerade eben mal einen Millionen-Dollar-Vertrag mit Paramount unterzeichnet haben, Ihre Sachen überarbeitet?
- Stimmt. Danke, dass Sie mich daran erinnert haben. Jetzt, wo ich es fast geschafft habe, diese Sache zu verdrängen.
- Jetzt überlegen Sie mal genau, sagte ich. Die zwei Dinge, die Sie am meisten lieben, verpassen Ihnen permanent einen Schlag ins Genick. Wie kann das überhaupt okay für Sie sein?
- Es muss okay sein, antwortete sie. Ansonsten…"
Sie verstummte, und ich spann ihren Gedanken weiter. "Ansonsten würde das heißen, dass Sie Ihre Tochter nicht wirklich lieben, dass Sie Ihr Schreiben nicht wirklich lieben. In Ihrem Begriff von Liebe gibt es einfach keinen Raum für Enttäuschung, keinen Raum, um sich verhindert, missverstanden oder missachtet zu fühlen, keinen Raum dafür, zu akzeptieren, dass Ihre Tochter und Ihr Schreiben Ihnen gelegentlich das Herz brechen.
Sie nickte. "Das stimmt. Ich darf eigentlich nur von mir selbst enttäuscht sein… auch wenn sie Fehler machen.
- Das ist der Punkt, sagte ich. Wenn wir etwas lieben, sei es unsere Arbeit, ein Partner oder ein Kind, dann sollten auch wir damit rechnen, von dem, was wir lieben, enttäuscht zu werden… und es einfach ertragen, wenn es uns enttäuscht. Denn wenn wir nicht verletzlich sind, haben wir auch kein Recht, unser Gefühl als Liebe zu bezeichnen.
- Jetzt fangen aber Sie an, mir auf die Nerven zu gehen…
- Ist schon klar. Denn wir haben auch eine Beziehung. Sie ist zwar etwas anders gestrickt als die, die Sie zu Ihrer Tochter oder zu Ihrer Arbeit haben. Wir setzen uns ja zusammen, um uns manchmal auf die Nerven zu gehen."
Diese Sätze musste sie erst einmal verdauen. "Also muss ich das alles ertragen und zulassen… diesen Ärger und alles andere, bis ich…
- Bis Sie damit im Reinen sind. Und dann wird sich das Ganze anders anfühlen, viel besser. Es kann zwar sein, dass es lange dauert. Ihre Beziehung zu Susie und auch die zu Ihrem Schreiben, das werden ganz schöne Wechselbäder. Aber ich wette darauf, dass Sie mit beidem Ihren persönlichen Frieden schließen werden, und zwar rechtzeitig."
Und so kam es auch.
Aber sie musste hart daran arbeiten, musste täglich mit eigenen Schwierigkeiten und darum kämpfen, angemessen auf ihre Tochter - und auf ihre Arbeit zu reagieren.
Damit komme ich zu meinem Ausgangspunkt zurück, und zwar zu dem Ziel, das zu erreichen für jeden Autoren fundamental ist: Die Entwicklung einer guten Beziehung zu sich selbst und zu seinem Talent. Mit anderen Worten: Erst einmal geht es darum, zu hinterfragen, ob du mit deinem Talent so umgehst, wie man mit dir als Kind umgegangen ist, und die nächste Frage ist dann, ob du dich damit, wie du mit deinem Talent umgehst, gut oder schlecht fühlst.
So, wie sich Kinder danach sehnen, dass sie akzeptiert werden und die Erwachsenen Vertrauen in sie haben, genau so müssen Autoren es lernen, sich selbst zu akzeptieren und zu vertrauen. Wenn dies gelingt, wird es einfacher, das eigene Schreiben zu akzeptieren und zu erkennen, welche Lehren man daraus ziehen kann - und nicht mehr dem nachzusinnen, was andere darüber denken.
Wie ein Kind, das geschätzt und geliebt wird, wird sich auch dein Text geschützt fühlen, und nicht bedrängt: Nur so entsteht der kreative Freiraum, der notwendig ist, etwas auszuprobieren, etwas zu riskieren, der auch Fehler und falsche Wendungen zulässt, was auch immer.
Und so wird für den Autoren, also für dich, nicht gleich jede Szene oder geschriebene Seite eine Frage über Leben oder Tod, sitzt nicht gnadenlos "Gericht" über deinen Wert und dein Talent.
Schließlich ist für den Autoren - wie für ein sorgendes und förderndes Elternteil, der absolut damit zufrieden ist, dass das Kind überhaupt ein Bild gemalt hat - eine "gute" Szene die, an der er gerade schreibt, ein "gutes" Treatment das, das er zu Ende bringt, und ein "guter" Tag am Computer der, an dem er sich hinsetzt und schreibt.
Denn letztendlich ist jedes Wort - so wie jedes Kind - wertvoll, ungeachtet seiner Kraft, Beredsamkeit oder Lebensfähigkeit. Dein Schreiben ist der fortwährende Ausdruck deiner subjektiven Erfahrung, dir selbst und der Welt dargebracht in der Hoffnung, dass es eine Verbindung eingeht; in der Hoffnung, etwas von dem aufscheinen zu lassen, was Menschen mit anderen Menschen verbindet, von dem, was uns menschlich macht.
Dennis Palumbo, M.A., MFT, ein früherer Hollywood-Drehbuchautor (My Favorite Year, Welcome Back, Kotter usw.), arbeitet heute als Psychotherapeut mit Privatpraxis. Er hat sich auf Kreativitätsfragen spezialisiert.